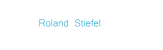Das Hundekloster eine Vision
Das Hundekloster ist ein symbolischer, unantastbarer, geschützter, fester Ort der Stille und der Innenkonzentration, der Einfühlung in fremde Not und des unbedingten und gewaltfreien Widerstands gegen Barbarei. Es gibt diesen Ort konkret nicht. Er ist Symbol unseres Anliegens: Das Wohl aller Lebewesen und der ganzen Kreatur, eine Konfliktversöhnung im kleinen und grossen und einen globalen Frieden. Der Ort kann in jedem einzelnen von uns sein.
Das fiktive Hundekloster wird in franziskanischem Geist geführt. Es verkörpert Mystik und Widerstand.
Inmitten gibt es das Hundekloster.
Wir sehen es nicht, aber es ist wie
selbstverständlich da.
Wir lieben dieses Kloster.
Es gibt dort weite Wege zum Beten
und gleichzeitig schützende Mauern.
Und es gibt im Kloster jedes Getier,
denn jedes Getier auf Erden ist wichtig.
Im Koster wird unbedingt geachtet
auf Frieden und Freundlichkeit
gegenüber allen Geschöpfen.
Nur so überleben wir alle.
In diesem Zusammenhang stehen die Hundegeschichten.
Hundegeschichten
mit Menschenschicksalen
Inhalt
0 Emma
1 Alain und Alain
2 Julie und Julia
3 Magda und Edwin
4 Martina
5 Daisy und Frau Siegrist
6 Nemo
7 Gurke
8 Rabauzz
9 Ein Hund
10 Kriegshund
11 Fussl und Fasel
12 Kati
13 Der GymHund
14 Die Hundeverbundenen
15 Knabe mit Hund
16 Die kürzeste Hundegeschichte der Welt
0 Emma
Emma, die Begleitung und Beruhigung fürs Leben, Emma, die Begleiterin für ins Sterben.
Sie war als Welpe in die zahlreiche Familie gekommen, wurde zu einer stattlichen, löwengelben Leonberger Hündin, liess sich von den Knirpsen liebkosen, brachte Welpen zur Welt und blieb immer auf dem Hof, freilaufend, ohne Kette, selbstbewusst, später häufig im Ruhezimmer beim Grossvater, dann wieder lange bei den Säuen, Kühen und Hühnern, immer wach, wachsam, zuverlässig und treu und gelassen-zugewandt, eine grossartige Mutterhündin.
Als der Grossvater ins Sterben kam, lag sie stundenlang im Zimmer und bewegte sich nur kurz hinaus, um Stall, Scheune und Hauseingang zu kontrollieren. Sohn und Tochter fanden dann die beiden nah nebeneinander. Bei einer der Hochzeiten trug Emma, altersschwach geworden, den kleinen Korb mit den Glückwunschkarten bedächtig im Maul zum Altar, die Taufe verbrachte sie liegend neben dem Pfarrer.
Früher hatte sie unter der Linde mit ihren Welpen gespielt, die waren längst weitergegeben zur Freude von guten Menschen.
Emma verkörperte in Wesen und Gestalt und gemeinsam mit ihren Mitmenschen ein grosses gelingendes Leben. Als sie gestorben war, gab ihr die Dorfmusik beim Hofbrunnen unter der Linde ein Ständchen.
1 Alain und Alain
Alles hat einen Anfang.
So kam Alain zu Alain.
Ich war damals noch klein, verstand wenig, aber spürte schon viel.
So auch das mit dem Hund. Meine Eltern hatten ein eigenes Haus, so eines in einer ganzen Reihe mit einem kleinen Garten, erworben. Mein Vater war
befördert worden. Sie waren betrübt, weil ich ein Einzelkind blieb, und wollten mir eine Freude machen. So kauften sie mir einen Hund für den Garten. Er hiess Alain. Er war viel zu gross für den Garten. Mein Kopf reichte ihm gerade bis zum Kopf. Aber er fand sich gut zurecht zwischen Sonnenschirm, Rattansofa und Fahnenstange. Wir tollten herum und legten uns keuchend und mit glänzenden lachenden Augen vor die Thujahecke.
Mit Alain lernte ich viele neue Wörter. Ich kannte schon ein paar und flüsterte sie ihm in seine grossen braunen Hängeohren. Er schnalzte mit der Zunge, schob sie über die Lefzen und gab mir die Pfote. Das ergab viele neue Wörter, zum Beispiel "Alain ist nicht allain, er ist laiblich, zeitlaiblich, zwaitleblich, zaitlich."
Aber Alain hatte zu wenig Bewegung. Er sprang stundenlang von Thujahecke zu Thujahecke. Ich sagte es der Mutter. Sie schüttelte den Kopf. Seit meiner Geburt hatte sie es in den Beinen und mein Vater war häufig auf Geschäftsreise. Er war nochmals befördert worden. Und was sollte ich Knirps denn mit so einem grossen Hund auf der Strasse? Meine Mutter war Befehlshaberin. Ich war jetzt in der zweiten Primarschulklasse und sollte gemäss meinen Eltern Zahnarzt werden. Aber die blutjunge Lehrerin schien ungeeignet für die entsprechende Vorbereitung und so kam ich aufs Internat, sechzig Kilometer weg.
Und Alain? Ist Alain jetzt all-ain? Im Reihenhaus nebenan waren neue Leute eingezogen. Aber dazwischen war die Thujahecke, man sah sich nicht. Natürlich suchte Alain Kontakt. Er schnüffelte hinüber. "Das sollst du nicht!" rief die Mutter. "Komm', Alain, komm'!" Da erschien knapp über der Hecke ein freundliches stilles Gesicht. Derr Mann nickte hinüber it glänzenden Augen. Jemand hatte seinen Namen gerufen.
Seine Frau sagte über die Hecke: "Er kann nicht mehr sprechen, schreiben kann er noch. Er hatte ein Schlägli. Aber er hört noch alles." Dann kam ein Karton über den Hag, darauf stand: "Ich heisse Alain." Es kam Heiterkeit in die Gärten.
Jetzt ging Herr Alain mit Hund Alain täglich auf lange Spaziergänge. Sie mussten nicht reden, sie schauten sich an, sie verstanden alles. Und sie lachten viel, Herr Alain lebte auf, sprach viel mit Alain, ohne dass man es hörte. Ich schrieb damals den Eltern: "Ich bleibe nicht mehr im Internat. Ich habe jetzt Internet. Und ich will zu Ali-en." Das hatte ich aus dem Google. "Was?" - "Zu Alain will ich!" - "Zu welchem?" - "Zu allen!"
So kam ich heim.. Grosse Begrüssung, viele Umarmungen, Streichels, Hundezungenküsse.
Herr Alain und ich unterhielten uns fortan mit seinem Notizblock. Alain mit dem grossen braunen Kopf und den Hängeohren hörte aufmerksam zu. Er hatte sowieso eine andere Sprache.
Wir erzählten uns vom Schlägli, vom Internat, von Hündinnen, und Alain stürmte schnüffelnd, bellend und restlos begeistert in den weiten Flussbogen. Wir blieben stehen, lachten, schauten uns an, drückten uns Hände und Pfoten.
Sie gehen dann alle drei mit viel Freude zusammen weiter.
2 Julie und Julia
Aufgewachsen in angeblich glücklichen Verhältnissen. Ihre Mutter war Französin, deshalb taufte man die Tochter "Julie". Ihr Vater war Marketingchef eines Weltkonzerns. Zur Dreikopffamilie kam später Julia, eine schöne schwarze Neufundländer Hündin aus bester Zucht, ein Welpe. Julie und Julia wurden eins. Mit vier wurde Juli im Weinkeller zum ersten Mal von ihrem Vater sexuell missbraucht. Die Mutter schwieg eisern in ihren Couturekleidern. Julie konnte sich in Julias dickem Fell verstecken. Sie bekam ihre ersten Depressionen. Sie litt übermässig an allem, was ins Leid, in Qual und Missbrauch geriet. Bei Bildern von Stierkämpfen bekam sie einen Schreikrampf. Sie ging nie an den Fluss, dort standen Fischer. Sie sah Flüchtlingszüge.. Sie lief zu Julia und heulte sich in sie hinein. Sie verlor die Stimme, ihr Leben war missbraucht, sie hatte jede Energie und jedes Vertrauen und jedes Selbstwertgefühl verloren. Ohne Liebe sind wir verloren. Keine Matur, kein Studium. Ihr Vater beging im Weinkeller des weiträumigen Hauses Selbstmord. Zuerst schoss er aus Verzweiflung in die Flaschen und stürzte dann in die Scherben. Es gab ein Durcheinander von Wein, Blut und Gehirn. Für Julie kamen die Klinikaufenthalte, Julia kam mit, legte im Park ihren breiten Kopf in Julies Schoss. Julie sah in die Augen von Julia, dieser mächtigen, ruhigen, starken Hündin, blickte in diese weit geöffneten, vertrauensvollen Augen voll restloser Zuwendung uud Liebe und summte vor sich hin, irgendein Lied von früher. Julia, die Trosthündin, übernahm Julies Leiden im Kopf, bekam Hirnhautentzündung. Für Wochen ging sie dem Tod entlang. Julie erstarkte in der Pflege der Hündin. Sie summte ihr stundenlang das Lied in die Ohren, viele weitere Lieder kamen ihr in den Sinn, ins Herz. Sie lagen nächtelang beieinander. Julia schaffte es. Und immer diese Lieder auf ihren langen Spaziergängen. Der Schmerz, das Leiden, die Qual, das Entsetzen und die Beruhigung, die Stillung des Schmerzes, die Befreiung: Alles ging in diese Lieder. Julie wurde entdeckt. Irgendein Freund der Familie war Musiker. Als er Julie singen hörte, brach er in Tränen aus. Später füllte sie Konzertsäle in aller Welt, immer dieselben zahllosen Lieder fürs Leben: Still, leidend, dann schreiend, tobend, voll Widerstand und Wut und dann der Durchbruch, das Licht, etwas sehr Reines, Stilles, Strahlendes, die Befreiung, der unsägliche Jubel. Ein immenses Programm fürs Leben. Abertausende wurden berührt und ergriffen. Julie wurde eine sehr starke, ausstrahlende Frau. Und immer Julia, die grosse schwarze Hündin an ihrer Seite mit ihrem wunderbaren Blick. Sie wartete und wachte in unzähligen Garderoberäumen und Schminkzimmern. Wenn Pausenbesucher hineinwollten, wurden sie schonungslos verbellt. Aber nur noch in der Erinnerung von Julie: Julia war längst gestorben. Sie hatte ihr Leben voll für Julie hingegeben. Und sie war immer noch da, gab Kraft, innerlich Julie war jetzt auf dem Businessmarkt, war in den Kommerz geraten. Die Manager drängten vor. Nach wenigen Jahren zog sie sich von allem zurück. Kein Applaus mehr. Und keine Geschäfte. Die Botschaft nicht verfälschen. Nur diese Lieder gegen das Leid. Mit Julia machte sie noch lange Spaziergänge - im Geist. Julie war glücklich und erschöpft. Jetzt sind sie nebeneinander begraben. Wer vorbeikommt, spürt eine seltsame strahlende kraft, die vom Stein herkommt, auf dem steht:
"Julie und Julia".
3 Magda und Edwin
"Als Magda in mein Leben kam, wurde dieses um es so zu sagen um zirka 98 Prozent verschoben. Ich bin Mathematiker und ich denke in Zahlen. Aber Magda wollte keine Zahlen, sie wollte mich."
Edwin spricht immer in der Ich-Form, weil er ist Autist. Also erlösen wir ihn und erzählen in der üblichen Distanzform.
Edwin arbeitet als Versicherungsmathematiker zu Hause. Er kann nicht in die Nähe von Menschen. Seine Mutter stellt ihm das Essen vor die Tür. Sein Studium war die Hölle. Er hat Angst vor den andern, vor ihren Berührungen. Er kann nur kurze Wegstücke gehen, die er schon kennt. Manchmal fuchtelt er mit den Armen, seine Kollegen bekamen Angst vor ihm. Aber als Fachmann ist er unentbehrlich. Er verkehrt nur mit Notizen. Und die Zahlen geben Halt. Seine Therapeutin, sie kommt jede Woche zu ihm an den Küchentisch, rät ihm, einen Hund zu sich zu nehmen. "Vielleicht einen, der sie braucht. Dann können sie aus sich heraus." Er studiert das Jahresheft eines riesigen rumänischen Tierheims, das heimatlose oder verstossene Hunde kurz vor ihrer staatlichen Tötung aufnimmt, kastriert und weiterzuvermitteln versucht. So stösst er auf das Bild von Magda. Sie wird als mittelgrosse, zurückhaltende, ängstliche alte Hündin beschrieben. Das wird schwierig. Aber ihr Bild berührt ihn irgendwie. Ihr hellbraunes Fell mit dunklen Streifen, ihre dicken Pfoten, der weisse Fleck auf der Brust, ihre Augen, auf ihn gerichtet, direkt auf ihn. Er bleibt lange an diesem Bild, diesen Augen hängen.
Wochen später wird sie ihm nach 24-stündiger Fahrt aus Rumänien irgendwann gegen Mitternacht gebracht. Sie sind beide unschlüssig, verwirrt, todmüde nach so viel Nervenproben, Ungewissheit und Überforderung.
Am nächsten Morgen nimmt Magda angespannt ein paar von seinen Cervelatstücken aus der Schüssel. Sie schlingt. Edwin schaut ihr gebannt zu. Sie hatte wohl nie genug zu essen in ihrem langen Leben. Er macht einen höchst anstrengenden Gang zur Migros, schaut um jede Ecke, starrt zurück, Schritt um Schritt, viele Erschöpfungspausen. Und kehrt mit einem mächtigen Sack zurück.
Magda muss geschlagen worden sein, bevor sie in die Smeura kam. Und lebte vielleicht in einem Verlies. Sie hat Angst vor geschlossenen Räumen, die Küchentür muss immer offen sein. Und sie hat Angst vor grossen Männern. Edwin ist gross. Er hat Angst vor offenen Räumen. Manchmal schauen sie sich wie entsetzt an.
Irgendwann muss Magda hinaus. Sie gehen langsam den Gärten entlang, Magda krumm mit ihren alten Gelenken, Edwin steif vor Selbstschutz. Was für eine warme Frühlingsluft. Und über die Wochen werden ihre Spaziergänge länger. Magda beginnt zu schnüffeln und Edwin schaut interessiert hin, wo sie schnüffelt. Einmal bellt Magda kurz und heiser über die Strasse zu einem Hund gegenüber. Sie will zu ihm, zieht hartnäckig an der Leine und wedelt. Es gibt ein kurzes freundliches Gespräch mit der Frau vom andern Hund. Ein paar Worte, wie eine Brücke. Und er schaut in die Augen von Magda, die jetzt aufrecht dasitzt: Dieser wunderbare, trotz allem Vergangenen hingebungsvolle, liebevolle Hundeblick. Edwin hat feuchte Augen. Einmal, vor eine befahrenen Strasse, gibt er, ängstlich im vielen Verkehr, der angeleinten Magda einen unkontrollierten Ruck. Magda zuckt zusammen, sie bleibt wie gefesselt stehen und aus ihrer Brust kommt ein tiefer einziger Schmerzenslaut. Es tut ihm in der Seele weh. Beide sind jetzt vereint in ihrer langen erlösten Leidensgeschichte.
Später gründet Edwin eine Familie. Magda bleibt noch für ein paar ruhige vertrauensvolle Altersjahre mit ihrem grossen anhaltenden Blick inmitten.
4 Martina
Der Mann war schwer depressiv. Und er soff. Sie wussten keinen anderen Weg mehr und schenkten ihm aufs Geratewohl und zur Gutenacht einen Vierbeiner. Dessen Besitzerin war gestorben, die Hündin kam für lange ins Tierheim, wurde ängstlich und misstrauisch und lethargisch und wer will schon so einen Hund. Auf ihren Namen "Martina" reagierte sie kaum mehr. So kam sie zum Säufergreis in die zerfledderte Wohnung voller Bücher. Er war Privatdozent für Hundpaläontologie gewesen, was vor allem er selber glaubte. Aber dann konnte er plötzlich haarscharf und mit blitzenden Augen berichten über was damals, wo wir Menschen, diese Kleinigkeit, jetzt siedeln, geschah. Und seine Universität mit dem Auditorium Maximum war irgendwo in seinem Kopf. Aber sie hielt ihn am Leben zwischen seinen Flaschen. Frühkindliche und lebensentmutigende Schädigungen, der Weggang irgendeiner Frau, der Drogenabgang seines Enkels, der Stierkampfstier im Blut, unsere Möglich-, Unmöglich- und Erbärmlichkeiten, die Totgeburt der Mörderin im Gefängnis im Freitagskrimi, der Anstieg des Meeresspiegels, die Flüchtlingsströme mit den Kindern mit ihrem Teddybär im Arm, das Sterben der Eisbären, die Staatsoberhäuptergängster und die Ausrottung der Klapperschlangen in Hinterindien für Luxusuhrenarmbänder -- all das und noch viel mehr und mehr in verknäultem Durcheinander hatte ihn aus der Bahn geworfen und zum Absturz gebracht.
Er lag viel auf dem Bett und rauchte durch die Decke zum Himmel. Aber keine Erbarmung von oben. Martina lag dann auch auf dem Bett. Sie hatte ihn angeschaut und musste gespürt haben: Der sitzt in der Wüste, aber er ist kein Wüstling. Hunde spüren es am Blick. Sie schaute in seine Augen, wenn er ihr, mühsam die Futterschüssel hinstellend, zuzwinkerte. So rückten sie zusammen. Martina fasste Vertrauen, der alte Mann bekam es mit der Liebe zu tun. Martina fragte mit ihren dunklen Augen: "Wie heisst du denn?" Der Mann schluckte. Er wartete lange, so lange wie Martina im Tierheim war, und dann erzählte er flüsternd in Bruchstücken: "Weisst du, ich war ein berühmter Hundpaläontologe und erforschte Spuren in uraltem Gestein, Pfotenspuren, Augenabdrücke, so schöne winzige Haarspuren in den Steinen. Aber dann habe ich alles verloren, es stimmt alles nicht, was wir wissen. Wir haben alles verloren, der Mensch macht das Letzte kaputt, auch die Hundpaläontologie, ich heisse Martin." Sie legten sich dann beide aufs Bett, schliefen eine Weile. "Die Hunde gibt es schon viel länger als uns. Und sie werden uns überleben. Sie sind stark. Du bist stark, Martina." Martin schnarcht. Martina leckt ihm den Arm. Sie gehen dann auf einen längeren schleppenden, schwankenden Spaziergang dem See entlang in der Frühlingssonne. Einmal bellt Martina kurz auf. Martin lächelt.
5 Daisy und Frau Siegrist
Frau Siegrist war unsere Nachbarin. Wir kannten sie vorerst einfach vom Sehen. Sie hatte diesen vorsichtigen trippelnden Gang, immer in Begleitung ihrer braunen Zwergpudelhündin. Diese starb später. Frau Siegrist bekam eine neue Zwergpudelhündin, eine schwarze. Was wir nicht wussten und erst später von anderen Nachbarn erfuhren: Bei Frau Siegrist hatte sich eine leichte Demenz eingestellt, zuerst in Mimik, Gestik und in kurzen Gesprächen kaum bemerkbar, aber sie verstärkte sich ziemlich rasch. Das Trippeln ihre Gangs wurde zu einem zögerlich unsicheren Vorwärtstasten. So ergab sich folgendes Bild, wie gesagt erst später durch die Nachbarn vermittelt: Daisy, so hiess die neue kleine Hündin, musste gleich bei ihrem Einzug bei Frau Siegrist gespürt haben, dass diese nur schwache und unbestimmte Anweisungen gab und kaum Einspruch erhob, wenn sich Daisy aufs Kopfkissen ihrer Herrin legte oder auf den Küchenstuhl sprang, um sich das restliche Essen von Frau Siegrist aus dem Porzellanteller vom Tisch zu holen. So wurde Daisy ohne Anmassung, eher aus einer sich einschleichenden Gewohnheit zur Herrin der kleinen gepflegten Wohnung und gab den Ton an, das heisst, sie bellte lautstark, wenn es Zeit für den Spaziergang war oder wenn Frau Siegrist noch tief schlief, obwohl schon seit zwei Stunden dünnes scharfes licht durch die Fensterläden drang, und schaute später winselnd nach, ob Frau Siegrist nur schlief oder schon... - Ein Hund spürt alles. Oder Daisy knurrte anhaltend, wenn Frau Siegrists Sohn kam und mit ihr über Finanzen und Testament reden wollte, und beruhigte sich erst, wenn sie wieder zu zweit waren und Frau Siegrist abwesend lächelnd "Pfötchengeben" wünschte.
Daisy musste gespürt haben, dass Frau Siegrist Führung brauchte und machte das aufmerksam, unermüdlich und loyal. Frau Siegrist war wie üblich eifrig und hartnäckig dabei, ihre wachsende Demenz zu verbergen. Sie war ihr Leben lang Angestellte und auf Beherrschung und Ordnung getrimmt gewesen. Wenig Kontakte, viel Sorgen und Ungefreutes, aber mit ihren kleinen Hunden in tiefem Einverständnis. So verhielt sich Daisy in Übereinstimmung mit ihrer zunehmend abwesenden Herrin. Diese wurde gestupst, wenn sie vergass, das Morgengeschäft von Daisy in den roten Kotsack zu verpacken. Oder sie blieb stehen und mahnte zur Rückkehr, wenn der Spaziergang zu lang wurde und sie am Halsband spürte, dass die alte Frau zu schwanken begann. Sie verbrachten dann lange Stunden in der dämmrigen Wohnung und Daisy, noch jung und lebhaft, schien sich mit der eingeschränkten Bewegungsfreiheit abzufinden. Immerhin wurde sie abwechslungsweise und täglich von den Nachbarn, die sich dank dem wohltuenden Kontakt zur Hündin mit Frau Siegrist angefreundet hatten, zu ausgiebigen Spaziergängen abgeholt. Auch die Kinder beteiligten sich daran. So bildete sich in der Nachbarschaft ein ganzes Menschenrudel für Daisy zu ihrer Entlastung und Entspannung von ihrer Daueraufgabe, für Frau Siegrist da zu sein. Daisy sorgte für geregelten Tagesablauf und führte die alte Frau je nach Tageszeit und Wetterlage und je nach beiderseitiger Stimmung in diese oder jene Richtung um den Häuserblock und vermittelte, wenn Kinder in der Nähe waren und indem sie Frau Siegrist stupste und aufbellte, angenehme kontrollierte Gesprächskontakte. Man lebte schön. Der Dank von Frau Siegrist an ihre kleine schwarze Hündin ist nicht überliefert. Das wird auch in einem täglichen überschaubaren Ritual geschehen sein, vielleicht mit kurzen Worten vor dem Einschlafen, beim Futtergeben, beim Streicheln mit den fahrig gewordenen Fingern. Ganz intim.
6 Nemo
Nemo ist ein unmöglicher Name. Heisst "niemand". Ein Hund hiess so. Im 15. Jahrhundert in Siena. Das spielt aber keine Rolle. Hunde sind zeitlos und nicht der Mentalitätsgeschichte des Menschen unterworfen. Die damaligen Umstände kommen aus der Geschichtsüberlieferung. Man könnte die Geschichte nicht schlimmer erfinden. Der Rest ist aus meinem Herzen erfunden.
Während des 14. Jahrhunderts hatte sich Siena in Politik, Handel und Kunst fast auf gleicher Höhe mit Florenz halten können. Im 15. erschöpfte es seine kraft durch Parteifehden, deren blinde Wut und Gewaltsamkeit in ganz Europa nicht ihresgleichen kannten. Fünf Parteien ("monti" = Hügel genannt) rissen sich gegenseitig andauernd die Herrschaft aus den Händen. Jede wurde der Reihe nach entthront und ihre einflussreichsten Anhänger, die manchmal in die Tausende gingen, verbannt. Wie erbittert diese Fehden waren, geht aus einem Bericht über eine Schwurzeremonie hervor, die im Jahr 1494 von wenigstens zwei Parteien zur Beendigung ihrer Feindseligkeiten veranstaltet wurde. Ein Augenzeuge, der dieser Szene mit Schaudern beigewohnt haben mag, erzählt, wie die zwei Parteien sich mitten in der Nacht in dem weiten, schwach erhellten Dom, jede abgesondert in einem Seitenschiff, feierlich verdammelten: "Die Bedingungen des Friedens (...) wurden verlesen, zusammen mit einer Eidesformel von allerschrecklichster Art, voll von Flüchen, Verwünschungen, Exkommunizierungen, Beschwörungen des Bösen und Androhungen von Konfiskationen (...). Selbst nicht in der Stunde des Todes sollte das Sakrament jene, welche die Bedingungen nicht einhielten, retten, sondern im Gegenteil sie in noch tiefere Verdammnis stürzen." Ein Zeugnis himmelhochjauchzender Verblendung und Selbstverherrlichung. Aus derartigen Fehden, Intrigen und Gewalttätigkeiten ging schliesslich die aristokratische Familie der Petrucci als Sieger hervor, so dass sich 1497 Pandolfo Petrucci zum Alleinherrscher aufschwingen und sich in gnadenlosem Übermut den Titel "Il Magnifico" selbstverleihen konnte, wobei seine Politik so oft ihre Zuflucht zu heimlichen Mordanschlägen nahm, dass die Allgemeinheit seinen Tod im Jahre 1512 mit Jubel begrüsste.
Dieser bereits verstorbene Petrucci hatte eine Tochter. Sie hiess Julia. Und aus einer der früher todverfeindeten Parteifamilien stammte der junge Romeo. Also kommt jetzt "Romeo and Julia of Siena" auf die Bühne. Nemo ist der Hauptdarsteller.
Die Geschichte geht einfach. Die schöne aufblühende Julia und der schöne stramme Romeo waren unsterblich ineinander verliebt und verlangten nacheinander, durften aber infolge des aristokratischen Menschenchaos in Siena im 15. Jahrhundert nicht. Nemo gehörte zu Julia, ein prächtiger, starker, ruhiger und vollkommen loyaler und offenherziger Hund, der die junge Frau beschützen sollte, was er als Mitglied ihres Rudels mit unbedingter Hingabe auch tat. Nun bekam er aber eine zusätzliche Aufgabe: Er sollte zum andern Rudel stossen mit einer lebensdringlichen Botschaft. Nemo beobachtete aufmerksam die Herrin, was sie wohl meinte und wohin er wohl sollte. Er verstand und lief los nachts durch die Gassen zwischen den verschlossenen Palästen auf leichten Pfoten durch schwarzes Mistrauen, durch Neid und Habgier mit einem kleinen feinen Brief am Halsband. Wenig späer kam er durchs Dunkel zurück mit einem feinen kleinen Brief am Halsband. Dazwischen liess der Petrucci Magnifico Leute hängen, vertreiben, foltern und erbaute sich an köstlichen Gesprächen mit Malern und Bildhauern, deren Gönner er war. Nemo aber trabte unentwegt und mit hellwachen Sinnen hin und her und linderte den Schmerz der Trennung der beiden Verliebten, vollzog den Brückenschlag und die Balance zwischen Liebessehnsucht und Lug und Trug und dem Schwachsinn der verfeindeten Familien, wurde zum Trosthund und stärkte das noch kindliche Vertrauen von Julia und Romeo. Bis eines Nachts, aus Missverständnis, Übermut oder Rache ein Bediensteter des Magnifico dem Nemo mit dem Dolch nachlief und ihn so schwer verwundete, dass er verstarb. Man überbrachte den kleinen Brief mitsamt der Hundeleiche dem Magnifico, der als grosser Jagdhundefreund galt. Der harte stolze Mann war zu Tränen gerührt. Romeo und Julia wurden zusammengeführt. Ihre Namen sind in den Adelsannalen verschwunden. Aber Nemo, der Niemand, der unabdingbar treue Vermittler und Friedensstifter, bleibt mir zeitlos im Herzen.
7 Gurke
Gurke ist kein Name. Kein Mensch heisst so, ein Hund schon.
Gurke lebte an einem kurzen Strick in zwei zerschnittenen und übereinander zusammengeklebten Bananenschachteln am Rand einer riesigen Wiese, worin sich Freilandhühner tummelten. Der Bauer hatte umgestellt. Die Eier verkauften sich gut. Die Schweinezucht hatte er wegen des Schweinefleischpreiszerfalls aufgegeben. Die Scheune war leer. Gurke, ein grosser schwarzer Labrador-Mischling, musste nichts mehr bewachen. Weshalb er so heisst, weiss niemand, auch er nicht.
Sein Kopf war länger als der Rassenstandard vorgibt und die lange Zunge hing ihm meist triefend aus dem Maul. Er war nichts als Hingabe.
Der Bauer händigte den beiden Tierschützern den Hund anstandslos aus und meinte: "Ein Maul weniger. Ich brauche genug Geld fürs Hühnerfutter."
Gurke hatte nie Liebe erhalten und wusste nicht, was das ist. jetzt, los vom Strick, verteilte er sie im Überschwang, bellte und stürmte und wollte Liebe und wurde beinah lästig. Auf der Rückfahrt wurde es Eva auf dem Hintersitz, neben ihr Gurke, unheimlich. Dieser atemberaubende Ansturm von liebe, die nasse schlabbernde Zunge, die Zungenküsse. Sie wechselten die Sitze. Eva und Schaggi, beide hatten ein gutes Herz, aber wenig praktischen Sinn: Wohin jetzt mit dem Hund?
Die Lebensfahrt, das Abenteuer, die Irrfahrt mit schlussendlich glücklicher Landung begann.
Eva arbeitet halbtags auf einer Gemeindeverwaltung im Fricktal, er ist Primarlehrer mit halbem Pensum in Rheinfelden. Sie können es spontan einrichten, dass sie am Vormittag, er am Nachmittag dem Beruf nachgeht. So bleibt Gurke für die ersten paar Tage nicht allein.
Er ist unmöglich. Er ist ja nie mit einer menschlichen Behausung und mit den zivilisierten Spielregeln unserer Spezies in Berührung gekommen. Schon am ersten Abend springt er, weil es dort so schön riecht, auf den Küchentisch und steckt die Schnauze tief in die Spaghettischüssel. Er tobt ins Schlafzimmer, verläuft sich im Doppelbett, schnüffelt unter dem Arbeitstisch und beginnt sich wie wild mit dem linken Hinterbein am Hals zu kratzen. Er hat Flöhe. Er jault auf vor Kratzlust. Dann springt er in den schmalen Gang und bearbeitet wie wild die Tür. Er ist begeistert und überfordert und will dauernd hoch aufgerichtet Zungenküsse geben. Nach ein paar Stunden klopfen die Mieter von nebenan. Und der Gang ist verkotzt und verkotet.
Schaggi und Eva besprechen sich flüsternd, lachend und verzweifelt. Ja, vorläufig Tierheim und eine Untersuchung beim Tierarzt. Sie machen Erspartes bereit. Schaggi holt Gurke jeden Tag im Tierheim ab und geht mit ihm an gestraffter Leine spazieren. Für Eva ist er zu stark und wild. Gurke muss sein Leben nachholen und alles erkunden, erschnüffeln, erfahren und anbellen. Einmal setzen sie sich nah zusammen - Gurke will unbedingt hinauf - auf eine rote, vom Turnverein gestiftete Bank am Waldrand. Gurke legt dem Schaggi den Kopf auf die Oberschenkel. Ruhig und lange spricht Schaggi mit Gurke. Und er verspricht Gurke: "Du wirst immer bei uns bleiben. Wir geben dich nicht weg. Du wirst immer bei uns sein." Gurke hält den Kopf schräg, seinerseits jetzt ganz ruhig und aufmerksam und schluckt Speichel vor Wohllust. Hunde vergessen nichts.
Aber wie schafft man das mit so viel Leben?
Gurke überschäumt vor Begeisterung für alles, was ihm begegnet. Und er ist unerfahren und arglos. Im Tierheim wird er von einem jungen Rottweiler am Hals bös gebissen. Das Personal hat nicht aufgepasst. Der Tierarzt nimmt das Tierheim in Schutz, es ist sein bester Kunde.
Jeden Freitag kommt der "Landanzeiger", eine Gratiszeitung mit vielen Kleininseraten. Schaggi studiert den Immobilienmarkt. Irgendein altes günstiges Bauernhaus mit Umschwung? Selbstverständlich ist die Suche sinnlos. Gibt es nicht oder ist viel zu teuer. Schaggi erwischt sich, wie er ganz für sich heimlich im Kopf an einem Kleininserat herumbastelt:
"Gesucht liebevollen Platz für anhänglichen, verträglichen Mischling..."
Mehr weiss Schaggi über Gurke auch nicht. Eva sagt er nichts. Aber er bekommt schwere Schuldgefühle, er hat Gurke verraten, jetzt sitzt der im Tierheim und wartet. Und ich liege hier neben Eva und denke an Gurke und ich weiss nicht, was Eva über mich und über Gurke denkt. Sie wollten doch Kinder. Denkt sie jetzt, das werde zu viel mit Gurke und Kindern? Und Schaggi hat schleichende Zweifel, die er sofort unterdrückt, ob ihm mit Gurke und Eva genügend freie Zeit bleibt neben der Schule. Schaggi malt; Aquarelle; so Wolkenbilder.
Eva und Schaggi beobachten einander, haben ihre Fragen und sprechen nicht darüber aus Scheu, etwas vorwegzunehmen, was keiner will. Gurke muss bleiben. Sie verbeissen sich in die Arbeit. Gurke wartet im Tierheim, jetzt schon seit einem Monat. Schaggi zieht sich zurück, malt stundenlang an seinen Wolkenbildern, die aussehen wie eine Gurke. Eva bekommt vor lauter Unklarheit und Ungewissheit Halluzinationen. Was, wenn alle Hunde in aller Welt ausstürben wegen einer globalen Pandemie? Nur Gurke bliebe zurück. Und der sitzt noch immer im Tierheim!
Darf man das Leben so verspielen?
Das Tierheim schickt eine weitere Rechnung. Schaggi hat die Stelle gekündigt, Eva ihre Arbeit aufgestockt. Gurke leert und schleckt die Futterschüssel offenbar bis zur letzten Flocke aus. Ein Junghund? Wie alt ist er überhaupt? Sie fragen beim Eierbauern nach. Der weiss nichts, will nichts wissen, hat nie einen Gurke gekannt. Sie holen den leutseligen alten Tierarzt mitsamt Gurke zu einer Flasche Wein. Er impft Gurke, schaut ihm ins Maul, begutachtet die Zähne und meint: "Ja, so etwa vier." Und ins Impfzeugnis schreibt er, etwas fahrig nach dem Wein, den Namen des Hundes mit "T" statt mit "G". Also Gurke bleibt. Aber der alte Veterinär spricht ein Schlusswort: "Hört, junge Leute, wenn die Gurke bei euch bleiben soll, muss er sich wohlfühlen mitsamt euch.
Aber ihr fühlt euch mitsamt nur wohl, wenn ihr der Meister bleibt. Er braucht Führung, klare Anweisungen, klare Zuwendung. Dann fühlt er sich wohl. Lebt wohl."
Eva und Schaggi haben in allem und jedem viel zu tun, ihr Leben ist ein einziger innerer Stress. Schaggi und Gurke sind täglich unterwegs. Sie werden eins. Aber Schaggi führt jetzt. Gurke fügt sich, wird zunehmend ruhiger. Eva wird eifersüchtig. "Ich verdiene schliesslich das Geld." Schaggi tut beleidigt. "Und Kinder kriegen wir auch nicht." Für Eva ist der Zapfen weg. Sie zieht aus. Gurke sucht tagelang nach ihren Kleidern, nach ihrem Geruch. Einmal, bei einem Spaziergang, bricht er aus. Eva ist zum Stiefvater ins Nachbardorf gezogen und macht oft Spaziergänge zwischen den beiden Dörfern, aus Heimweh, aus Sehnsucht nah allem. Gurke hat ihre Spur entdeckt. Er läuft und läuft, er kratzt an der fremden Wohnungstür, wartet, winselt.
Das Doppelbett ist wieder besetzt. Gurke schläft am unteren Bettrand. Weiter nach oben darf er nicht. Er schnauft aus, akzeptiert und schläft beruhigt ein.
Beim Frühstück versuchen sie ein Gespräch. Dann sprechen sie nicht mehr, sie handeln. Sie ziehen weg. Gurke hat die innere Führung übernommen.
Auch Eva hat gekündigt. Sie stehen vor dem Leeren. Die Leere ist nicht leer, sondern offen. Gurke zeigt den Weg. Auf einem Spaziergang stöbert er im Gebüsch einen alten halbverhungerten Hundemix auf. Er ist offensichtlich ausgesetzt worden. Er ist nicht gechipt. Gurke wünscht, dass sie den Hund bei sich aufnehmen. Sie machen das. Sie wohnen in zwei Zimmern bei Schaggis Tante. Das Haus liegt abseits inmitten von Wiesen. Bald tummeln sich dort
vier Notfallhunde, dann sieben. Die Tante schiesst Geld vor. Das Veterinäramt kommt vorbei. "Was, dieser grosse Schwarze ist ein Turke?" - "Nein, der kommt doch aus Wallbach." Sie lachen sich halbtot. Jeden Samstag fährt Schaggi auf den Trödelmarkt nach Basel und verkauft dort für Kleingeld seine Aquarelle mit Gurke in den Wolken. Immerhin. Eva betreut tagsüber Kinder von allein erziehenden Müttern. Geld für Futter. Die Tante, die gute, stirbt und hinterlässt das Haus und ein geringes Vermögen. "Gurke", sagen sie zu Gurke, "wir sind über den Berg. Danke."
Aber hinter dem Berg kommt Neuland. Ihnen ward ein Kind geboren. Und sie haben jetzt total zehn Hunde. Die Gemeindeverwaltung muss gemäss Verwaltungsreglement einschreiten. Muss. Belästigung der Anwohner, die immerhin vierhundert Meter entfernt sind, wegen Lärmerzeugung. Schaggi und Eva sprechen vor, sprechen mit den Anwohnern. Es sind auch Kinder dabei. "Wie geht es Roky?" - "Und Grischa?" - Und dem Fritz und Ronja?" Grosse glänzende Kinderaugen. Sie kennen die Hunde nur von weitem oder höchstens einem Streichel über den Hag, Eva und Schaggi sind vorsichtig. Aber jetzt: "Wollen wir einmal zusammen mit den Hunden spazieren gehen?" - Ja, ja, ja!"
Am nächsten Tag geht es über Wiesen, dem Fluss entlang, dann in die Hügel. Ein Rudel Hunde, achtzehn sind es jetzt, und begeisterte Kinder hinterher - man kann sich nichts Schöneres wünschen. Die Hunde kennen sich alle. Es sind stürmische dabei, wilde Draufgänger, dann stille, langsame, die Alten, Müden, und Geniesser, die jeden Grashalm beschnuppern wollen. Gurke hat seine Aufgabe erkannt. Er hält das Rudel beisammen, bleibt hinten, bellt, stupst, läuft nach vorn, bringt die Ausgeflippten zurück. Einige sind angeleint. Es gibt keine Aggression, kein Raufen, das Rudel gehört zusammen, und Gurke gibt Ordnung und Sicherheit. Die uralte lebenswichtige Verbindung von Hund und Mensch wird neu gelebt. Gurke aus der Banenschachtel ist der Inspirator.
Du lernst viel Freundlichkeit mit den Vierbeinfreunden. Hunde sind auf sehr feinen Empfang gestellt. Wenn Menschen streiten, ducken sie sich weg und wenn du sanft mit ihnen sprichst, lässt dich Gurke nicht aus seinen schönen Augen. Hunde haben ein Tausendfachresonanzsystem, das Erbe der Wölfe. Gibt einer Laut, stimmt in anderer ein, und ein dritter, weiter hinten, will auch dabei sein und bellt zurück. Sie verstehen uns nicht wörtlich, sie verstehen den Silbenklang und den Rhythmus unserer Worte, die Schwingung, woraus die Welt besteht. Kinder verstehen das noch.
Sie werden berühmt, die Kinder-Hunde-Wanderungen von Rheinfelden im Rudel. Kindergärten kommen, Schulklassen. Schaggi erklärt, gibt Anweisungen, Verhaltensregeln. Eva lacht in die strahlenden Gesichter, nimmt die Kleinen bei der Hand samt Felicitas, ihre eigene kleine Tochter. Und Gurke sitzt etwas abseits mit seiner langen Zunge und den grossen Ohren, gespannt, ruhig, aufmerksam, bereit für seinen grossen Einsatz für eine bunte, fröhliche, respektvolle Wanderung mit Kindern und Hunden auf uralten Wegen durch Wiesen und Wälder über dem Fluss. "Kommen die Hunde mit, wenn ich tot bin?" fragt ein Kind.
8 Rabauzz
Die Epidemie wird zur Pandemie. Und Rabauzz ist mittendrin, das heisst in der Schweiz. Dass das Virus für Hunde weder als Empfänger noch als Spender gefährlich ist, weiss er nicht, aber er bemerkt mit steigendem Unbehagen, dass man ihn nicht mehr von der Leine lässt. "Ich komme vom Wolf", knurrt er, "und der war nicht an der Leine." - "Fuss!" tönt es vom Mensch. "Los!" fletscht Rabauzz. Er durchbeisst die Leine und läuft in die Wälder. Er wird zum Wanderwolf. Wölfe können das Virus verbreiten. Er trabt durch halb Europa, überquert Gebirge, schwimmt durch Flüsse, zeigt sich in Städten, auf Autobahnen. Und er stösst seinen heissen Atem, voll virusgesättigt, zu den Menschen. "Ich will zurück", heult Rabauzz durch die Nacht, ich will mein Revier zurück". - "Wir sind verloren", heulen die Menschen". Die Sirenen heulen. "Bleibt in den Häusern." Die Wolfsrudel sind zurück. Sie besetzen und verteidigen ihr Gebiet. Sie zeugen Junge, machen Beute, fressen, raufen, reissen Beute, wandern. Unermüdlich und hochorganisiert. "Ihr seid viel zu viele, ihr Menschen, ihr habt uns das Land genommen und alles besetzt. Ihr seid viel zu viele, wir bringen euch das Virus." Rabauzz trabt über tausend Kilometer immer zu den Menschen. "Wir brauchen Equlibrio." Bei der Überquerung des Apennin hat er Italienisch gelernt.
"Komm', Rabusi, mach' schön Fuss", sagt der Mensch. Rabauzz geht im Gleichschritt. Einmal schnüffelt er kurz, hebt das Bein.
9 Ein Hund
Man hört ihn von weitem. Einheimische kennen sein Gekläff von weitem. Er gehört zum Dorf. Er kennt nur die Nähe um seine Hütte in Reichweite der Kette. Sein Gekläff wird weit herum gehört. Es wirkt bruhigend, nachts und aus Distanz, bevor man einschläft. Das Dorf verliert sich nicht ganz in der Stille. Tagsüber hört man nicht mehr hin, es wäre ärgerlich, es immer zu hören.
Als achtwöchiger Welpe ist er zu seiner Hütte und zu seiner Kette gekommen. Seither gehört er einem Menschen. Vorher war er bei seiner Mutter, die kleinen Pfoten an ihren warmen Bauch gedrückt, in dem er blind und gut versorgt gelegen hatte. Ein Mensch ist dazwischengekommen. Dieser nahm ihn, durch Absprache mit einem anderen Menschen, noch bevor er auf der Welt war, in Besitz, gab ihm einen Namen, auf den er seither hört, was überflüssig ist: Er ist ja immer hier, an der Kette.
Nach zehn oder zwölf Jahren hat man die rote Futterschüssel aus Plastik durch eine gelbe ersetzt. Die rote war zernagt, zerbissen, durchlöchert.
Zu seinem Unglück ist er auf die Welt gekommen. Jetzt muss er leben, das kann man nicht rückgängig machen,. Der Bauer würde straffällig, wenn er ihn einfach so erschlüge.
Auf der Kommode steht, an den Schützenbecher gelehnt, ein Foto von ihm als Welpen, die Rückseite trägt in verblasster Schrift seinen Namen: Er blinzelt in die Welt, bereit für zärtliche Berührungen, die er mit den Pfoten, den Schnauze, der Zunge erwidert hätte - so weich und zärtlich, so locker, wie kein Mensch das kann.
Aber der Bastard ist klein geblieben. Damit hat der Bauer nicht gerechnet. Jeder könnt den Hund mit einem Fusstritt wegschleudern. Allerdings gibt es längst nichts mehr zu bewachen. Die Hühner sind hinter Gitter, die Kälber in Boxen, die Kühe an den Geräten; es ist alles aufgeräumt und gesichert. Der Hund ist übriggeblieben. Er nützt nichts, aber er lebt.
Früher hat er tagelang geheult und gewinselt, seit Jahren kläfft er. Er könnte den Rest verdösen, aber seine Sinne lassen ihm keine Ruhe. Er riecht, hört, sieht noch alles - obwohl sich in seiner kleinen Umgebung nichts ändert. Auf ausgiebigen Hundewanderungen hätte er seine empfindlichen Organe geschult: Wie man fein abgestimmt auf unzählige Begegnungen reagiert; wie man Winziges, hundertfach Wichtiges wahrnimmt, mit der Nase, den Ohren, den Augen, und wie man das alles blitzschnell verarbeitet, im Stehenbleiben, Weiterlaufen, im begeisterten Bellen und Hinterherjagen. Er hat das nie spüren dürfen. Jetzt kann er nur kläffen, voller Angst an gestraffter Kette. Er kann nicht weg, alles bedroht ihn. Immer um Viertel nach zwölf geht der verhasste Nachbar zum Briefkasten. Ein Fremder kommt vorbei, der Hund kann ihn nicht erkunden, beschnuppern und einschätzen.
Die Katze legt sich mittags auf das Sonnenplätzchen zwischen Hauswand und Scheune, beobachtet ihn aus angemessener Distanz, wie er sich jeden Tag in seinem eintönigen Gebell verbraucht. Aber manchmal, bevor sie sich für die restlichen Stunden verzieht, kommt sie zu ihm, streicht um seine Beine, die sofort, sobald sie die Nähe spüren, beruhigt einknicken. Sie lecken sich das Fell, liegen beieinander für eine Stunde und man hört nichts mehr.
Später ist der Nachbar gestorben. Für die nächsten zwei Jahre galt das Gekläff seiner Witwe, sie hatte einmal einen Stein nach dem Hund geworfen. Jetzt ist auch sie nicht mehr da.
Zuzüger am Hang oben haben reklamiert. Sie hören stündlich den Hund, haben ihn noch nie gesehen, hassen ihn seit Monaten. Sie arbeiten in der Stadt, sind wegen Ruhebedürfnis aufs Land gezogen. Der Bauer hat am Telefon Besserung versprochen. Aber auf den Hof gehöre ein Hund. Und sie kaufen bei ihm die Eier. Es nützt nichts. Man kann den kleinen Hund kürzer befestigen, die Kette einfach doppelt legen - er kläfft um so durchdringender. Er ist da, man kann nichts erledigen. Der Hund folgt einem in die Arbeit und in den Schlaf. Besser, man zwingt sich zum Weghören. Sein Gekläff ist überflüssig. Die Alteingesessenen wissen es. Es gibt ja nichts zu bewachen. Es ist längst alles versichert. Der Bauernhof gehört der Bank. Wenn man sich jederzeit auf Sinnloses konzentrierte, würde man verrückt. Auch die nachgeborenen Kinder haben sich daran gewöhnt. Der kleine Hund an der Kette gehört zum Dorf. Man muss es für normal halten. Er gehört zum Dorf, es gehört sich für einen Hund. Wenn sich eine Qual restlos in Gewohnheit verliert, gibt es sie nicht mehr.
Manchmal kläfft der Hund ohne Unterbruch eine Stunde lang, streckt sich dann erschöpft vor der Hütte aus, bevor ihn ein neues alltägliches Geräusch hochreisst. Es sind ja alle im Alltag, sie machen nie Neues, der Hund kennt nichts Neues, er muss auf alle Wiederholungen bitter vor Angst reagieren. Sein Gekläff kommt durch offene Fenster in die Stuben, sonntags geht es den Kirchgängern nach in die Kirche, vermischt sich mit den Glocken und der Orgel.
Manchmal, wenn jemand langsam vorbeikommt und im Vorbeigehen irgendetwas halblaut und ruhig zu ihm sagt, blickt er wie erstaunt hin, wie wenn er sich an etwas längst Verlorenes erinnerte, er steht verdutzt und wie erstarrt vor der Hütte und bewegt zaghaft die Schwanzspitze.
Über Nacht ist Schnee gefallen. Ein eiskalter blendender Morgen. Spuren führen in gerader Linie von der Haustür an der Hundehütte vorbei. Aus dem Schopf gegenüber holt jeden Morgen der Bauernjunge sein Fahrrad. Links davon: Spuren von Hundepfoten, in einem Halbkreis, den Radius, den die Kette zulässt, abbildend. Der Hund muss vielleicht jaulend und wedelnd auf den Knaben, mit dem er das Alter teilt, zugesprungen sein. Aber die Linien der Geraden und des Halbkreises berühren sich nicht: Zwei Meter Distanz dazwischen. Die gleichmässigen Spuren der Stiefelsohlen bezeugen: Der Junge ist nicht nähergetreten, auch nicht stehen geblieben; er hat sein Fahrrad geholt, ist auf der gegenüberliegenden Seite aufgestiegen. Der kleine gleichaltrige Hund muss langsam zu seiner Hütte zurückgekehrt, in diese gekrochen sein. Man merkt es, wenn man den aufgeregten Wirrwarr der Pfotenspuren lange anschaut und ordnet. Der Schnee verrät, was vielleicht jeden Morgen geschieht.
Der Junge ist längst in der Schule. Er lernt etwas, er lernt viel, er ist noch jung, er kann es zu etwas bringen. Die Bäuerin räumt auf. Samstagmorgen. Die Zuzüger schlafen noch. Jemand arbeitet unentwegt im Takt und ohne aufzuschauen mit der Schneeschaufel vor seinem Haus. Die Bäuerin wischt Staub von der Kommode. Sie stellt das Foto mit dem Welpen wieder gerade hin. Der Hund liegt in der Hütte, ein Stück Kette liegt vor der Hütte, er benötigt es nicht. Der Schnee dämpft alle Verrichtungen, die Gerüche sind zugedeckt, es kommt niemand vorbei, das Winterlicht auf der Fläche zwischen Scheune und Hügel blendet, man muss die Augen schliessen. Der Hund bleibt für Stunden ruhig. Aus der Nähe würde man sehen, wie er drin liegt: Ein kleiner, schwarzweiss gefleckter Bastardkörper, die Schnauze auf die Strohhalme zwischen den Latten gedrückt, schnaufend, vielleicht schnarchend, der kleine Bauch in ständigem ruhigem Auf und Ab. Aber man darf nicht in die Nähe kommen. Er würde ja sofort herausschiessen und kläffen, einen ankläffen. Man darf nicht nahe sein.
10 Kriegshund
Im Fernsehen sah man das Bild: Menschen auf der Flucht vor den anrückenden Truppen, eine Gruppe balanciert über den Notsteg über dem reissenden Fluss neben der bombardierten Brücke, Männer, Frauen, Kinder notdürftig mit wenig Sack und Pack, zuhinterst ein Hund, der ausrutscht, ein Mann reisst ihn noch am Halsband hoch, rutscht aber selber aus, der Hund verschwindet in der schäumenden Flut.
Es ist nicht das Ende. Kein Tier braucht den Menschen als Begleiter und Beschützer mehr als ein Hund. Dieser Hund von der Brücke gehört längst niemandem mehr. Er bleibt auf der Flucht. Zwei Jahre zuvor ist er als Junghund als Geschenk zu einer Tochter nach Kiew gekommen. Sie wurden engste Spielgefährten, Dann kamen die ersten Bombenangriffe, veranlasst von einem Banditen, es kamen Terror, Vertreibungen, Zerstörungsgier, Verstümmelungen, Folterungen, Vergewaltigungen, ausgeführt von Abschaum, Nichtmenschen. Der Vater packte Tochter und Hund, die Mutter war bereits umgekommen, für auf die Flucht. Ihr Auto wurde zerbombt, nur der Hund überlebt, ein feindlicher Soldat riss ihn aus dem Auto, gab ihm ein Stück Soldatenbrot und jagte ihn in die Weite. So kam der Hund zum Fluss, der ihn mitriss. Der Hund entkommt. Er steht jetzt erschöpft am Ufer, schüttelt das Fell, fassungslos in diesem leeren Kriegsland. Das Land entleert sich, zahllose Menschen sind auf der Flucht. Überfüllte Nachtzüge rollen Richtung Polen. Man hat einen Korridor ausgehandelt. Verzweifelte Menschen binden ihre Hunde an Laternenpfähle und heulen ihnen aus dem Zug nach. Viele Flüchtlinge schaffen es nach Polen, einige nach Deutschland. Wer noch einen Hund bei sich hat, muss ihn ins Tierheim abgeben. Unser Hund bleibt wieder irgendwo hängen im Niemandsland.
Er hat einen Namen, aber den kennt keiner. Er bleibt ein Niemand, aber stark im Willen, zu überleben. Er läuft tagelang, schläft zwischendurch in einem Waldstück, läuft und läuft. Irgendwann bleibt er, erschöpft von Hunger, Durst und vom Laufen, vor einem Waldhaus, eher Hütte als Haus, liegen und erwacht erst wieder, als ein Mann mit schwerem Werkzeug zwischen Bäumen auftaucht. "Wie heisst du denn?" fragt der Bärtige. Der Hund zögert, bewegt die Rute und blickt dann vertrauensvoll nach dessen erneutem ruhigem Zuspruch zu diesem Menschen hin. Der öffnet die Tür, bringt später Nahrung, Wasser, eine Decke. Sie bleiben beisammen. "Ich heisse Nepomuk, sie sagen mir so, weil ich Brücken flicke. Und du heisst jetzt Adalbert". Erneutes Schwanzwedeln. Nachts Raketen, dumpfe Einschläge, stundenlang. Der Feind verschanzt sich und verharrt. Nepomuk und Adalbert ziehen jeden Morgen zum Fluss. Eine der Brücken ist wieder beschädigt. Nepomuk schuftet. Adalbert bewacht den Zugang.
11 Fussl und Fasel
Fussl wird aus einer ungarischen Tötungsstation via Wien, wo er wohl seinen derzeitigen österreichisch tönenden Namen erhalten hat, zur Autobahnausfahrt Salzburg, wo er von Fasel abgeholt wird, gebracht, wonach ihm eine weitere Fahrt von sechs Stunden bevorsteht, bevor er in Lenzburg, es ist Nacht geworden, den Leuten, die ihn übernehmen, mitsamt seinen Papieren (Impfausweis und sonstige Atteste für seine Existenz) ausgehändigt wird.
Bei der kurzen Übergabe bei Salzburg erkennt Fasel leidlich ein kleines weisses, flauschiges Wesen, völlig still in den Armen des Überbringers und mit einem Ausdruck in den dunklen Augen und der kleinen schwarzen Nase, der sagt: Ich will leben, so spürt es Fasel, ausschliesslich leben.
Fasel hat seinen Namen aus jungen Jahren, damals hat er viel und scheinbar wahllos aus innerer Unruhe geredet und Geschichten erfunden, der Übername ist ihm liebevoll geblieben. Aus Dankbarkeit für das Leben, wie er sich sagt, macht er noch so Dienstfahrten für Hunde. Mit achtzig will er dann aufhören. Und jetzt steuert er Fussl, der lautlos in seinem Korb auf dem Hintersitz liegt, durch die weite verzettelte Gegend. Berge, dann Hügel, Dörfer, eine Stadt, ein Bootshafen, Einzelhäuser, Reihenhäuser, langsam dämmert es. Er will mit Fussl reden, flüstert seinen Namen nach hinten, aber der reagiert nicht. Er wartet, denkt Fasel, der Hund versteht nichts, er hatte bestimmt so einen ungarischen Namen, und jetzt ist er ausgeliefert. Abgeliefert aus der Tötungsstation, übergeben worden und wieder übergeben an Leute, die fremd riechen, anders sprechen, und jetzt in diesem Kessel von Verkehrsgeräuschen drin, die ihn lähmen. Oder aber Fussl äugt vielleicht entspannt zu ihm hin, wartet einfach ab, fühlt sich womöglich hoffentlich gut im Moment? Fussl regt sich nicht. Fassl erträgt es nicht, aber er kann nicht anhalten, sie sind im Abendstossverkehr. Er erträgt es nicht, wenn es still ist hier drin, totenstill?
Jetzt mache ich so Hundedienstfahrten, denkt Fasel, um noch einen Sinn zu haben, habe ja so vieles vergeudet, vertanes Leben, Frau, keine Kinder, Freunde, Vermögen, die Liebe, verschwunden, verloren, er soll es gut haben, der Fussl, und Fasel erfindet Lebensgeschichten für Fussl, gute, schöne, liebevolle, frohgemute, und rollt mit dem Plastikkorb auf dem Hintersitz durch die Nacht. So ein Hund kann ja nichts tun. Er kommt zur Welt, kommt zu Kindern oder
an die Kette, wird behütet und betreut oder ausgesetzt oder erschlagen. Er ist uns völlig ausgeliefert. Fasel beschleunigt. "Du kommst zu guten Menschen, Fussl", raunt er nach hinten, "ich kenne sie nicht, aber wir haben Vertrauen, gäll Fussl!" Seine Geschichten sollen wahr werden. Alle kommen zusammen. Sie haben vor dem Bahnhof abgemacht. Da stehen Leute unter der Strassenlampe, Kinder. Sie winken scheu und wild. Und jedes will Fussl zuerst streicheln. Fasel sieht das weisse Wesen auf Kinderarmen in einem Auto verschwinden. "Mach's gut, Fussl!" Fasel kommen die Tränen. Kurzer Kinderjubel durchs Dunkel. Türenschlagen.
12 Kati
Manchmal wedelt Kati nur mit dem Schwanz, erhebt sich nicht, wenn sie merkt, dass ich im Haus bleibe. Auch tagsüber schläft sie jetzt fast immer. Nur noch kurze selbstständige Spaziergänge im Garten hinter dem Haus. Nach dem Postaustragen habe ich viel Zeit. Ich schaue ihr zu, wie sie zwischen den Sträuchern herumsteht, herumschnuppert. Dann trottet sie wieder an ihren Platz in der Küche, bettet sich auf ihren Tüchern zurecht, streckt sich ein paarmal umständlich, rollt sich ein oder legt sich aufatmend langausgestreckt hin, je nach Temperatur oder eigener Stimmung, die ich manchmal, längst nicht nicht immer, aus ihrem Blick errate. Dann schläft sie wieder ein. Sie schnarcht oder winselt vor sich hin, bewegt die Vorderpfoten wie im Laufen; sie seufzt auf. Es tönt wie bei Menschen. Oder werden Menschen, die schlafen, wie freundliche Tiere?
Zwischendurch verfolgt sie mich mit ihren Augen, die nichts mehr richtig sehen. Sie ist schon in ihrer alten Gier einer Katze nachgelaufen, dann wie verloren stehen geblieben,, als ob sie vergessen hätte, was der Trieb mit ihr wollte., und schwanzwedelnd und verlegen zurückgekommen. Ihre Welt ist klein geworden.
Oder es ist, wie wenn ihr etwas in den Sinn käme, und sie geht langsam eg, aber es ist dann auch nicht so wichtig. Oder sie sitzt einfach ein wenig da.
Ich muss aufmerksam bleiben, ihr Eigensinn rechnet nicht mit uns Menschen: Im Sommer bewegen sich dichte Autokolonnen durchs Dorf; die Fremden fahren durch, seeaufwärts, blicken nur nach vorn. Sie wäre sofort zwischen den Rädern.
Abends, wenn es kühler wird, gehe ich mit ihr für eine halbe Stunde dem Ufer entlang. Die Wasservögel kümmern sie kaum mehr; sie schaut nur hin, senkt den Kopf, knurrt leise, wedelt dann mit dem Schwanz. Sie muss spüren, dass für ihren umständlichen Körper alles unmöglich geworden ist: Das federnde Hinabspringen von der Mauer auf die klobigen Steine, das Hinterherhetzen, das begeisterte Bellen. Sie wedelt nur noch. Oder sie trabt halbverdrossen, weil ihr Instinkt es befiehlt, auf einer Spur, verliert sie aber bald, kommt fast erleichtert zurück.
Nachts erbricht sie oft ihr Essen. Ihr Magen ist gestört, will nicht mehr recht, kann nicht mehr alles behalten, verarbeiten, weitergeben. Das Häufchen Speise liegt dann zwischen den Pfoten,. Ihre Brotbrocken, die sie abends bekommt, dreht sie nur noch im Maul; wichtig ist, dass ich sie ihr gebe, es gehört zum Ablauf ihrer Stunden, dass sie abends etwas von mir bekommt, sie bleibt regelmässig vor mir sitzen; und mit gedämpfter Begeisterung trägt sie die Brotstücklein weg, beschnuppert sie auf ihren Kissen.
Sie ist auf mich angewiesen, braucht viel Geduld. Sie braucht viel Schlaf. Jedes Wesen hat seinen Platz, möchte diesen eine Weile behalten. Ich schaue ihr zu. Manchmal wird sie mir fremd, wie sie sich beharrlich zurückzieht in ihren Schlaf, nur noch kurz herausblinzelt aus ihrer Welt, dann darin versinkt. Ich warte dann. Manchmal rühre ich mich nicht mehr. Sie würde leicht aufwachen, müsste, weil es ihr so anerzogen worden ist, auf meinen Zuspruch, auf ihren Namen reagieren. Sie braucht viel Schlaf, damit sie noch eine Weile durchhält in ihrem Leben, ich warte, vielleicht zögert dann der Tod. Kati ist mein Lebensgeschenk.
Fünfzehn Jahre. Man denkt nach, wenn man so wartet, was man geworden ist mit seinem komplizierten Kopf in dieser Zeit.
Wir brauchen uns. Ich bin besorgt, wenn ich in mein kleines Haus mit den drei Zimmern zurückomme, in die Lautlosigkeit, und Kati sich nicht zeigt. Ich muss dann sofort nachsehen; schäme mich fast, wenn ich sie so daliegen sehe, gleichmässig atmend; wir müssen immer nachprüfen, hinlangen und stören, wo wir sowieso nichts ändern können - und verlernen so das Vertrauen in anderes Leben.
Sie braucht mich, wird unruhig, wenn sie aufwacht, mich nicht sofort findet. Sie folgt mir, ich höre ihre ungelenken Pfoten auf dem Holzboden; sie legt sich dann irgendwo nieder, den Kopf flach zwischen den Pfoten, sie beobachtet mich. Soweit es ihre Sinne noch erlauben: Immer auf der Suche nach Nähe. Frühmorgens kommt sie schwerfällig die Treppe zu meinem Bett im Giebel hinauf; sie ist schon ausgerutscht; seither ist sie noch behutsamer, man hört es.
Manchmal bin ich schon wach, aber das Geräusch ihrer Pfoten, die zu mir hinauf wollen, holt mich ab aus dem Schlaf. In letzter Zeit kommt sie sehr früh, manchmal schon um vier. Vielleicht spielt die Witterung eine Rolle; oder irgendwelche Bewegungen und Erschütterungen in der Atmosphäre, die wir verursachen und nicht merken; ein Hund spürt sie. Oder sie hat geträumt, ist aufgeschreckt, braucht Nähe. - Was wissen wir schon?
Über Stunden leben wir beisammen lautlos im Haus. Der Hund muss mir gefolgt sein, wartet in einer Ecke, entlässt mich nicht aus dem Blick. Vielleicht hat er schon lange gewartet, als ich nachdachte oder eingeschlafen war; neben dem Möbelstück unverwandt die matten Augen, so unverwandt, als ob sie nicht mehr ganz zum Körper gehörten. Ich muss dann rasch aufstehen, mich bewegen, Kati streicheln, ihren Atem spüren. Ich nicke jetzt oft tagsüber ein; nachts bleibt der Schlaf für Stunden weg, seit Wochen schon. Wenn man es erklären könnte, wäre es leichter auszuhalten. Aber vielleicht wäre dann nur eine fremde Erklärung in einem drin. Das Schicksal der Käfer an den Hängen nimmt mich in Beschlag.
So dösen wir beide im Schatten, jeder auf seine Weise erschöpft, eine Zeitlang vor uns hin - jetzt an diesen glühenden Nachmittagen, wo sich alles Leben zurückzieht, bei sich sein will, kein Windstoss den Birnbaum und die Buchenhecke aus ihrer Starre erlöst, nur manchmal streift der Schatten des Gabelweihs, der lautlos herabkommt, die Mauer gegenüber; und ich kann dann nicht mehr unterscheiden: Habe ich soeben im Halbschlaf gestöhnt, oder war es Katis Bauch neben mir. Im Kopf bin ich an den Hängen. Morgen, bevor die Hitze kommt, muss ich wieder hinauf. Käfer retten. Es ist übermässig. Aber es ist ein Auftrag von jenseits. Es ist in mir drin.
Kati will dann gestreichelt werden, steigert sich plötzlich in die alte Heftigkeit ihrer Zuneigung, hat aber bald genug; sie schnauft nachher, verzieht sich ins Haus. Wenn ich rufe, geschieht nichts; oder sie blickt, wenn ihr Name kommt, in die falsche Richtung; sie hört fast nichts mehr. Sie ist ganz wehrlos geworden, könnte nichts mehr verteidigen. Sie gehört wieder ganz sich selber in diesem Stück Leben, das ihr bleibt. Sie ist mein Lebensgeschenk.
Gestern ist Kati nicht mehr aufgewacht. Die Brotstücke von gestern und vorgestern lagen neben ihr. Man kann die Pfoten berühren, den Bauch, di Schnauze - es ist alles steif, schon ein wenig kühl. Man kann die Pfoten so hinlegen, wie wenn sie liefen, an den Hängen, dem Ufer entlang, über die Almend. Man horcht nach. Aber sie ist weit weg. selbstständig. Es gehört einem nichts. Man war ein Begleiter. Doch sie bleibt in mir drin, Kati, ihre Freude, ihre unaufhörliche Aufmerksamkeit, ihre Lust, ihre unbedingte Verbundenheit. Sie bleibt, ich muss weiter, Käfer retten, steige die Hänge hinauf.
13 Der GymHund
"Gym" ist die Abkürzung für Gymnasium. Und "Hund" steht für einen mächtigen Irish Wolfhound-Rüden mit Schulterhöhe 81 cm, wohnhaft zumeist im Gymnasium. So ein freundlicher, gelassener grauer Riese ist eine herzerwärmende Erscheinung. Aber was heisst "wohnhaft" an einer höheren Schule?
Hier beginnt die Geschichte mit Abraham, der nur sieben Jahre alt wurde. Früher hiess er Flöhchen.
Das Gymnasium war eine junge Schule, gegründet in einer Zeit, als die kantonale Bildungsplanung aus dem Ruder lief. Der erste Rektor brauchte nicht nur hochwertige Lehrkräfte, sondern vor allem genügend Schülerinnen und Schüler, sonst wäre das Gymi eingegangen. Und so holte man junge Heranwachsende auch von jenseits der Kantonsgrenze und tangierte so die Bildungshoheit. Man tangierte aber auch die soziale Hoheit mitsamt ihren Vorurteilen. Eine Schülerin von weiter weg kam mit einem Hund, dessen Kopf ihr fast bis an die Brüste reichte. Es war Flöhchen. Die Schülerin war Mutter geworden, wollte aber unbedingt die Matur machen. Ihre Eltern übernahmen den Säugling. Im Gegenzug übernahm und betreute sie tagsüber den Hund, der vor zwei Jahren als niedlicher Welpe zur Familie gekommen und eben, weil so herzig war, den genannten Namen erhalten hatte. Schon in der ersten Schulstunde wurde Flöhchen umgetauft. Die Klasse war begeistert und voll Respekt. Sie hatten gerade Geschichte. Der Lehrer ein sehr liebenswürdig-engagierter, glatzköpfiger, mit theologischem Einschlag Gesegneter, erzählte weitschweifig und langweilig und viel Stammbäumen von einem, der Abraham hiess. "So soll er heissen!" tönt es von hinten. Abraham hebt den Kopf. Es scheppert zur Pause. Alle wollen mit dem Riesen hinaus. Und dann stehen sie ein wenig verlegen um den mächtigen grau-struppigen Tierkörper herum. "Darf man ihn streicheln?" Abraham schaut um sich, lässt alle heran und behält seine naturgegebene Ruhe und Würde. "Braucht er viel Bewegung?" Sie organisieren einen ersten Spaziergang für nach dem Nachmittagsunterricht. Und so wachsen die Empfänglichen unter ihnen mit Abraham zu einem Rudel heran.
Die Mathe-Prüfung steht an. Ziemliche Aufregung in der Klasse. Auch beim Lehrer. Der Notenschnitt liegt im Vergleich zu den Parallelklassen zu tief für ein halbes Jahr vor der Matur. Er kramt noch in den A4-Blättern für den Test. Abraham, den Kopf auf den Füssen der jungen Mutter, hebt ihn rasch und schnüffelt am Schuh des ziemlich feierlich vorbeigehenden und Blätter austeilenden Junglehrers. "Wird schon werden", meint Abraham, "schauen wir", drückt die Schnauze auf den Boden und schnauft tief durch. Ein kurzes entspanntes Lachen geht durch die Reihen. "Er ist so lässig", flüstert eine. - "Echt Psycho, er ist ein Therapiehund für Zaghafte und Verzweifelte, spricht der Herr, mein Gott." Der Junglehrer hat sich brüsk umgedreht, schaut aber nicht auf die Kugelschreiber, Taschenrechner und was weiss ich, sondern in die Augen von Abraham, in diesen wunderbaren, unentwegten, ruhigen und unbedingten Hundeblick. "Machen Sie's gut", sagt er gedehnt und bestimmt und setzt sich vorn hinters Pult, den Beobachterposten für gegen den Spick. Abraham döst.
Nach zwei Stunden Geräuschlosigkeit im Prüfungszimmer ist der Stress vorbei. Aber es gab mehrfachen Blickkontakt zwischen dem Examinator und dem ihm zublinzelnden Abraham. Nervöses Getuschel jetzt, banges Fragen und hochgradiges Belehren unter den bald Erwachsenen. Der Junglehrer aber ist in den zwei Stunden zum Hundeflüsterer und spirituellen Menschenversteher avanciert. Er schlägt vor, dass Abraham die mit den Klausurblättern gefüllte Kartonmappe ins Lehrerzimmer trägt. "Es wird Ihren Noten guttun." Abraham ist schon aufgestanden, wartet mit geöffnetem Maul und trabt dann los durch die Gänge.
Heute ist Frau Kisenowski an der Reihe, eine russischstämmige, pädagogisch durchgebrühte Mitfünfzigerin, schönbeinig, mitteilsam und liebenswürdig, eine prädestinierte Französischlehrerin. Abraham mag den Gang, die Intonation und Artikulation der fernen Russin, obwohl in der Ukraine gerade Krieg ist. Aber Abraham kennt sich da nicht aus, ist auch schon zu lange her mit diesen Kriegen, er selber stammt ja aus der Bibel, von einem Putin oder so hat er noch nie was gehört. Er sitzt neben Frau Kisenowski und lauscht ihrer schönen Sprachmelodie. Nachher ist Spaziergang. Hunde lieben das Immergleiche, Herr Marschalker auch. Er schliesst sich dem Spaziergang an. Er ist Deutscher und Physiklehrer und will sofort die Führung übernehmen. Abraham, in sicherem Gespür für Völkerfrieden, stellt sich unübersehbar vor ihn und trabt leichtfüssig voraus. Wäre da noch Fräulein Seewadel, also "Fräulein" ist ja heuttags verpönt, hat Abraham gehört, also lieber Frau lic.phil.II Seekohl, Abraham seufzt, er bringt in seinem schon dreijährigen Kopf alles durcheinander, aber Demenz ist ja heute in Mode, und Frau Dr. Seekohl, sie hat inzwischen noch eine Diss. verfasst, seufzt, weil die Klasse schon wieder alle chemischen Formeln vergessen hat. Da kommt der Biolehrer und erzählt vom Gerät, das alles erledigt. Du kannst die Noten eintippen und innert Sekunden hast du den Schnitt und kannst ihn für ewig speichern. Und wieso Formeln auswendig lernen? Die holst du dir doch alle vom Bildschirm. Die Welt wird kompakt. Wir brauchen keine Bücherschwarten mehr. Abraham hebt das Bein bei der alten Buche und pisst konzentriert.
A propos Alter: Abraham mit seinen drei Jahren gehört inzwischen zum Schulinventar. Die damalige Klasse hat ihre Matur absolviert und kommende Schülerschaften wissen schon Bescheid: In der Schule lebt Abraham. Wir können ihn täglich sehen und mit ihm sprechen. Er hilft uns über die Scheisse.
Das war so: Bei einem Schüler kurz vor der Matur wird Epilepsie diagnostiziert. Die Schulleitung ist informiert. Mündliche Deutschmatur, eine Viertelstunde lang. Der Schüler kann mit Texten, mit gedichteten Texten rein gar nichts anfangen, er gerät in totalen Stress und die Prüfung wird in einen epileptischen Anfall stürzen. Man kommt überein: Abraham soll während der Prüfung unter dem Tisch des Schülers liegen und ihn so hilf Gott mit seiner ruhigen mächtigen körperlichen Anwesenheit beruhigen. Der Schüler starrt auf den Text. Es ist Scheisse ein Gedicht. Pause. Der Anfall hockt hinterm Stuhl, auf dem der Schüler zu schwitzen beginnt. Abraham scheint es zu spüren, leckt einmal kurz die herabhängende junge Menschenhand. Der Examinator bemerkt: "Lesen Sie uns den Text doch einmal langsam vor." Der Schüler, mit stockender Stimme, hebt an. Abraham leckt unterm Tisch jetzt intensiv die verkrampfte Hand, die sich allmählich ganz leicht, das spürt nur eine Hundezunge, löst. Und die Schülerstimme beginnt zu schwingen. Ende der Lesung. "Das genügt", meint der Examinator, der Experte am hinteren Tisch nickt. "Sie haben so schön gelesen, auch der Hund wurde ganz aufmerksam. Ich glaube, Sie haben das Gedicht verstanden. Lassen wir's bleiben." Die Geschichte wird berühmt. Abraham, der Gedichtversteher. Alle finden das Vorgehen und die genügende Schlussnote richtig. "So was von menschlich am Gym - mega!" ruft eine Schülerin.
Wieder eine diesjährige Maturfeier. Eine Lehrerin hält die Festrede in der von Eltern, Geschwistern, Tanten, Mitschülern und Bekannten und nochmals Verwandten überfüllten Mehrzweckhalle. Sie spricht vom jetzt ins volle Lebengehen, von Stolz und Zuversichtsfreude, sie gratuliert und warnt und ermutigt und klatscht am Schluss selber mit. Für das Gruppenfoto wird Abraham auf die Bühne mitten in die jungen Menschen geholt. Er setzt sich sehr kontrolliert und blickt gefasst und würdig und reglos in die Kamera und in der Halle erhebt sich tosender Beifall, Standing Ovations für Abraham, mehr als für einen Sportstar. Vor der anschliessenden Schülerband mit Sax und Schlagzeug geht er auf Spaziergang. Ist ihm zu laut. Aber der Klang in der Stimme jener Lehrerin ist noch in ihm drin, eine anhaltende Schwingung: "...ins volle Leben gehen...".
Abraham wurde lediglich sieben Jahre alt. Man weiss das von der Rasse: Sie wurde überzüchtet, man wollte möglichst grosse Begleithunde. Das ging auf Kosten der Gesundheit. Die grossrahmigen Irish Wolfhounds sind anfällig für Gelenkbeschwerden, Herzerkrankungen und Knochenkrebs. Und eine Lungenentzündung kann lebensbedrohlich werden und rasch zum Tod führen. Eine geringe Lebenserwartung für Abraham, menschgemacht.
Sie sitzen mit Abraham am Fluss und werfen Steine in den Fluss. Abraham schaut interessiert, aber seltsam reglos unverwandt zu. Mittagspause. Septemberlicht. Alle wohlig ausgestreckt in der verbleibenden Wärme, gehen dann langsam und entspannt zurück. Es wartet wieder eine Klausur. Abraham wird im Gang warten, zur Beruhigung. Ganze Schülergenerationen kennen ihn nun. Und er kennt jede Schülerin, jeden Schüler, er kennt sie am Geruch, am Gang, an der Stimme und macht kurze oder ausführliche Begrüssungen. Kein Schulanfang am Morgen ohne Abraham. Er sitzt beim Portal, aufmerksam, entspannt und es entgeht ihm nichts. Ist eine traurig, einer nervös, jemand übermüdet oder verzweifelt - Abraham spürt es sofort und macht je nachdem eine ausführliche heilende Begrüssung und verzieht sich dann ruhig und ungelenk in eine geräumige dunkle Ecke, er hat es in den Knochen, "passt doch auf!", ruft jemand, "da liegt Abraham."
Der Herbst geht ins Land. Abraham döst in der Sonne. Vor Weihnacht steht wieder eine Matur an, die letzte für Abraham. Manche haben es gespürt, auch die älteren Lehrkräfte mit Erfahrung. "Es ist etwas in seinem Blick, er schaut wie durch einen hindurch, passt auf ihn auf." - "Da ist nichts mehr aufzupassen. Er geht seinen Gang. Es ist biblisch." Man lächelt und ist irgendwo berührt. Es kommt unerwartet, wie alles, wo die Hoffnung noch werkt. "Er war doch gestern noch bei uns in der Klasse. Und er ging zu jedem hin." Über Nacht hatte Abraham seine Lungenentzündung. Vier Stunden Bangen am Morgen. Abraham meist schon im Tiefschlaf. Dann sieht der Tierarzt keine Rettung mehr.
Es geht ein Raunen durchs Gymi. Bald wissen es alle. Der Rektor kommt in jedes Klassenzimmer, spricht ein paar Worte. Erstarrung, Beschämung, Schluchzen, eine Schmerzeiseskälte, ein paar umschlingen sich, einer macht zur Entlastung beiseite einen Witz. Die meisten dieser jungen Menschen haben noch kaum Erfahrung mit dem Tod. Ihre Grosseltern sind zumeist soweit noch rüstig. Und jetzt dieses Loch. Abraham braucht Zeit, viel Zeit. Sie geben sie ihm und sich selbst. Auch Ehemalige kommen und lassen sich von den letzten Monaten erzählen. Septemberlicht am Fluss. Eine sagt; "Ohne Abraham wäre ich jetzt nicht an der Uni."
Der Zeichenlehrer kommt mit einem Vorschlag: "Ich mache einen Entwurf für ein kleines Denkmal, aus Sandstein, grau wie Abraham war." Sie einigen sich auf die Frühlingsferien und in Dutzenden Trupps arbeiten sie abwechslungsweise unermüdlich am Erinnerungsbild aus Stein für Abraham. "Das ist gut für die Seele, der Schmerz wird transformiert oder transzendiert", sagt der Psychilehrer. Sie schauen weg. Jetzt sitzt Abraham da vor dem Portal wie er immer sass und niemand geht ungerührt vorüber oder hinein. "Ist doch irgendeswie biblisch", meint der inzwischen pensionierte glatzköpfige Lehrer von vorhin und lächelt.
14 Die Hundeverbundenen
Sie haben sich vorher nicht gekannt. Jemand hat ein Inserat gemacht und sie haben sich versammelt, Alte, Junge, Mittelalterliche und viele Kinder, mit ihren Hunden: Arthos, Töbeli, Sitta, Grigia, Nenja, Ronja, Hummel, Lia, Hektor, Rollo, King-Kong, Whisky, Maya, Felix, Cordula, Rosamunda.
Im Inserat stand: "Hunde sind gut fürs Leben. Wir gehen mit ihnen dorthin, wo man sie braucht und wo sie gut tun. Das Leben ist ein Zusammenhang."
Die Menschen gehen mit den Hunden und die Lebensfreude und die Lust am Leben samt Trost und Zuversicht gehen mit. Die Menschengruppe schweigt, man hört nur das Geräusch der Hunde, die bellen, schnüffeln, schnuppern, schlabbern, kurz knurren, pissen, winseln, jaulen, hecheln, kratzen, laufen, und sie springen an dir hoch und wollen Streichels, und sie äugen, hören, riechen, ziehen an der Leine, wollen Nähe, sie sind begeistert oder warten gespannt ab, senken und heben die Rute, sind unablässig in Bewegung und in Aufmerksamkeit für Begegnung, Nähe und Rudel, und ihre Augen begegnen dir mit Glanz, Wärme und unergründlicher Treue und Wachsamkeit, allzeit bereit für Freude und Miteinanderleben.
Der Hundezug wartet abends an den Bahnhöfen auf die abgehetzten Pendlerzüge, die Hunde warten vor Spitälern, sie ziehen in Altersheime, gruppieren sich um die Sessel und die Rollstühle, der Hundezug wartet ganz ruhig und konzentriert nach der Abdankung auf dem Friedhof, es gab einen Riss im Leben, aber wir geben uns nicht verloren, wird schon wieder werden, das Leben und die Lebensfreude sind starke Begleiter, und sie gehen weiter, ein festes Rudel, ein geschwisterliches Ineinander und sie stehen auf dem Platz vor dem riesigen alten Schlachthof und warten ziemlich reglos und warten. Wird schon werden, sagt der Mann mit dem Inserat, wir sind da.
15 Knabe mit Hund
Ein Knabe geht unten vorbei. Er hat einen kleinen schwarz und braun gefleckten Hund bei sich. Er muss ihn der Nachbarin bringen. Der Hund gehört der Nachbarin. Er hat sich verlaufen. Ist noch jung. Was weiss ich.
Der Knabe hat den kleinen Hund auf dem Arm. Er geht und stolpert, so sehr ist er beim Hund. Er kann fast nicht atmen vor Glück.
Nach fünf Minuten kommt er wieder die Strasse hinunter. Er hält die Arme vor sich hin, immer noch so vor sich hin in die Luft: Dort lag vorhin der kleine Hund. Er dreht sich einmal und will jetzt laufen. Er bleibt stehen, er blickt auf seine Arme. Das Glück will einfach nicht weg.
16 Die kürzeste Hundegeschichte der Welt
Er hiess Bobi, hat lange mit uns gelebt und hat unser Herz erfreut. Schon wahrscheinlich viele viele Hunde vor ihm hiessen Bobi. Unser Bobi war einzig. Er war unser einziger Bobi. Jetzt ist er gestorben und unser Herz jammert lang. Aber es werden womöglich noch viele Hunde, die Bobi heissen, zu Menschen kommen. Sie werden alle einzig sein.